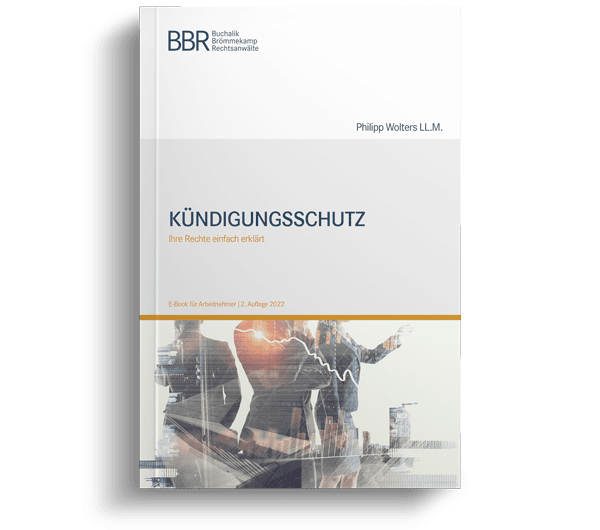Kündigungsschutzklage
Eine Kündigung muss nicht das Ende bedeuten: Mit einer Kündigungsschutzklage können Sie sich effektiv gegen ungerechtfertigte Kündigungen zur Wehr setzen. Dieser Artikel bietet Ihnen alle wesentlichen Informationen dazu.
Es ist für viele oftmals ein Schock, wenn ihr Arbeitgeber die Kündigung des Arbeitsverhältnisses erklärt. Der Verlust des Arbeitsplatzes sorgt für Existenzängste und nicht wenige empfinden dies auch als eigenes Versagen. Dabei gibt es die Möglichkeit, sich mit Hilfe einer Kündigungsschutzklage gegen eine rechtswidrige Kündigung zur Wehr zu setzen. Dieser Artikel liefert wichtige Information zu der komplexen Materie und schafft somit einen ersten Überblick.
1. Kündigungsschutz und Kündigungsschutzklage
Es kann unterschiedliche Gründe dafür geben, die einen Arbeitgeber dazu veranlassen ein Arbeitsverhältnis beenden zu wollen. Damit der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber jedoch nicht völlig schutzlos ausgeliefert ist, fordert das deutsche Arbeitsrecht für die Wirksamkeit einer Kündigung das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen.
Wie weit der Kündigungsschutz im Einzelfall gilt, richtet sich insbesondere nach der individuellen Betriebsgröße. Dabei gilt ein Unternehmen mit 10 Arbeitnehmern oder weniger als Kleinbetrieb, sodass lediglich die gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen gelten. Diese ergeben sich aus verschiedenen Gesetzen oder zum Beispiel dem Arbeits- oder Tarifvertrag.
Beschäftigt das Unternehmen mehr als 10 Arbeitnehmer und hat das Arbeitsverhältnis bei Zugang der Kündigung mindestens seit sechs Monaten ohne Unterbrechung bestanden, findet hingegen der allgemeine Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz Anwendung. Danach ist die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber nur unter der zusätzlichen Voraussetzung zulässig, dass sie sozial gerechtfertigt ist. Dies ist dann der Fall, wenn sie aus personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Gründen erfolgt.
Darüber hinaus gewährt das deutsche Arbeitsrecht bestimmten Personengruppen wie zum Beispiel Schwangeren noch einmal erweiterten Sonderkündigungsschutz vor einer ungerechtfertigten Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Unabhängig vom Umfang des im Einzelfall bestehenden Kündigungsschutzes gilt jedoch, dass sich jeder Arbeitnehmer gerichtlich gegen eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses wehren kann. Dies gilt also auch für Beschäftigte von Kleinbetrieben, wobei die Erfolgsaussichten aufgrund des eingeschränkten Kündigungsschutzes in der Regel niedriger sind.
Um die Wirksamkeit der Kündigung überprüfen zu lassen, muss der betroffene Arbeitnehmer rechtzeitig bei dem zuständigen Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage einreichen.
 Was ist Kündigungsschutz? Welche Kündigungsgründe gibt es? Wie läuft ein Kündigungsschutzprozess ab? Rechtsanwalt Philipp Wolters LL.M. beantwortet die häufigsten Fragen rund um den Kündigungsschutz!
Was ist Kündigungsschutz? Welche Kündigungsgründe gibt es? Wie läuft ein Kündigungsschutzprozess ab? Rechtsanwalt Philipp Wolters LL.M. beantwortet die häufigsten Fragen rund um den Kündigungsschutz!
Ihre Rechte einfach erklärt: Hier geht’s zum E-Book für Arbeitnehmer.
2. Warum eine Kündigungsschutzklage erheben?
Die Erhebung einer Kündigungsschutzklage dient in erster Linie der gerichtlichen Feststellung, ob das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung wirksam aufgelöst wurde oder nicht.
a. Dabei ist zu beachten, dass man die Kündigungsschutzklage grundsätzlich innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung bei dem zuständigen Arbeitsgericht schriftlich einreichen muss, § 4 KSchG.
Wird die Kündigungsschutzklage nicht innerhalb der 3-Wochen-Frist erhoben, gilt die Kündigung nach als von Anfang an rechtswirksam. Der betroffene Arbeitnehmer hat dann nach deutschem Arbeitsrecht nur noch unter ganz engen Voraussetzungen die Möglichkeit, sich gegen die Kündigung zu wehren. Es ist daher dringend davon abzuraten, die 3-Wochen-Frist verstreichen zu lassen.
Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung fest, besteht das Arbeitsverhältnis zunächst fort. Der Arbeitnehmer muss weiter zur Arbeit erscheinen. Eine Abfindung erhält der Kläger entgegen landläufiger Meinung zwar grundsätzlich nicht, der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet dem Arbeitnehmer rückwirkend das seit Kündigung gegebenenfalls noch ausstehende Gehalt zu zahlen.
Die Kündigungsschutzklage ermöglicht daher eine rechtssichere Einstufung der Kündigung als wirksam oder unwirksam. Das Gerichtsurteil beendet den Streit zwischen den Parteien und ermöglicht so auch einen gedanklichen Abschluss der Angelegenheit. Lassen Sie sich bei Unsicherheit von einem fachkundigen Anwalt oder einer Kanzlei mit Schwerpunkt Arbeitsrecht beraten.
b. Hat der klagende Arbeitnehmer kein Interesse mehr für seinen bisherigen Arbeitgeber tätig zu sein, lohnt sich die Erhebung einer Kündigungsschutzklage in der Regel trotzdem. Denn oftmals verstoßen Kündigungen gegen formelle Vorschriften oder sind zum Beispiel sozial ungerechtfertigt.
Da sich eine Kündigungsschutzklage unter Umständen über einen gewissen Zeitraum zieht und der gekündigte Arbeitnehmer während dieser Zeit in der Regel nicht mehr aktiv für den Arbeitgeber tätig ist, kann der mögliche Verlust des Prozesses aufgrund der dann bestehenden Nachzahlungspflicht des Gehalts ein erhebliches finanzielles Risiko für den Arbeitgeber darstellen.
Dieser Umstand eröffnet im Falle einer nicht eindeutig wirksamen Kündigung einen gewissen Spielraum für Vergleichsverhandlungen mit dem Arbeitgeber. Diese Möglichkeit entgeht einem, wenn man auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage von vornherein verzichtet.
c. Ist die Kündigung unwirksam, dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses jedoch unzumutbar, kann das Arbeitsverhältnis gem. § 9 KSchG auf Antrag des klagenden Arbeitnehmers aufgelöst und der Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung verurteilt werden. Auch diese Option steht einem jedoch nur im Rahmen einer Kündigungsschutzklage zur Verfügung.
Da die arbeitsrechtlichen Bestimmungen komplex und vielfältig sind, ist im Falle einer Kündigung dringend eine arbeitsrechtliche Beratung zu empfehlen. Ein erfahrener Anwalt ist in der Lage, im Einzelfall eine fundierte Einschätzung der Rechtslage vorzunehmen und daraus die optimale Vorgehensweise zu bestimmen.
3. Voraussetzungen einer Kündigungsschutzklage
Wie bereits ausgeführt muss der klagewillige Arbeitnehmer die Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen ab Erhalt der Kündigung schriftlich bei dem zuständigen Arbeitsgericht einreichen, § 4 KSchG.
Welches Arbeitsgericht zuständig ist, lässt sich zum Beispiel über das Justizportal des Bundes und der Länder herausfinden. Wird die Kündigungsschutzklage dennoch bei einem örtlich unzuständigen Arbeitsgericht erhoben, stellt dieses seine Unzuständigkeit fest und verweist den Rechtsstreit stattdessen an das örtlich zuständige Arbeitsgericht. Die 3-Wochen-Frist bleibt in diesem Fall grundsätzlich gewahrt.
Die Klage muss man schriftlich einreichen. Es reicht also nicht, eine E-Mail zu schicken.
Eine explizite Benennung des Schriftstücks als Kündigungsschutzklage ist nicht zwingend erforderlich. Es genügt grundsätzlich, wenn der Wille gegen eine erhaltene Kündigung vorgehen zu wollen ausreichend dokumentiert ist.
Die Kündigungsschutzklage kann der Arbeitnehmer grundsätzlich ohne Anwalt selbst einreichen. Eine anwaltliche Vertretung hierbei sowie im Rahmen des Prozesses in der ersten Instanz ist nicht zwingend erforderlich. Dennoch ist von einem Alleingang ohne anwaltliche Unterstützung dringend abzuraten.
Das Kündigungsschutzrecht ist aufgrund einer Vielzahl von Vorschriften und umfangreicher Rechtsprechung äußerst komplex. Der Arbeitgeber wird hoher Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall anwaltlich vertreten sein, sodass man einem Experten mit meist langjähriger Erfahrung gegenübersteht, der diese Situation im Zweifel für seinen Mandanten geschickt zu nutzen weiß.
Es ist zudem nicht die Aufgabe des Gerichts, dem nicht anwaltlich vertretenen Arbeitnehmer Rechtstipps zu erteilen und das Verfahren zu seinen Gunsten zu führen.
Schließlich bedeutet eine gerichtliche Auseinandersetzung für die meisten Betroffenen eine hohe emotionale Belastung, die eine selbständige Verteidigung ohne fachkundige Unterstützung noch aussichtsloser macht.
Sie sollten daher unbedingt einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens zu Rate ziehen und mit der Wahrung Ihrer Interessen betrauen. Die anwaltliche Vertretung verursacht zwar Kosten, allerdings besteht dadurch auch eine deutlich höhere Chance auf eine angemessene Abfindung sowie eine insgesamt bessere Wahrung der Rechte des Arbeitnehmers. Oder wussten Sie, dass man im Rahmen eines Vergleichs neben einer Abfindung auch noch andere Dinge wie zum Beispiel eine Zeugnisregelung abstimmen kann?
4. 3-Wochen-Frist bei Kündigungsschutzklage beachten!
Wir haben bereits mehrfach auf die 3-Wochen-Frist für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage hingewiesen. Da die Einhaltung dieser Frist für die erfolgreiche Geltendmachung Ihrer Rechte bei einer Kündigung elementar ist, wollen wir diese Frist an dieser Stelle noch einmal etwas ausführlicher thematisieren.
Die einheitliche Klagefrist von drei Wochen, § 4 KSchG, gilt für alle Kündigungsschutzklagen. Der Arbeitnehmer muss also unabhängig vom Grund für die Unwirksamkeit der Kündigung (zum Beispiel fehlende Betriebsratsanhörung, Formunwirksamkeit der Kündigung, Nichtbeachtung besonderen Kündigungsschutzes, Nichtbeachtung der objektiv richtigen Kündigungsfrist bei einer ordentlichen Arbeitgeberkündigung usw.) jede Unwirksamkeit einer Arbeitgeberkündigung innerhalb von drei Wochen durch Klage beim Arbeitsgericht geltend machen.
Die dreiwöchige Klagefrist ist auch einzuhalten, wenn die ordentliche Kündigung gegen das Kündigungsverbot des § 15 Abs. 3 TzBfG verstößt, weil der befristete Vertrag weder die Möglichkeit vorsieht, das Arbeitsverhältnis ordentlich zu kündigen noch die Anwendbarkeit eines Tarifvertrags vereinbart ist, der ein solches Kündigungsrecht enthält.
Die dreiwöchige Klagefrist beginnt erst mit Zugang einer schriftlichen Kündigung. Ergänzend wird in § 5 Abs. 1 Satz 2 KSchG festgelegt, dass eine nachträgliche Klageerhebung zulässig ist, wenn eine schwangere Arbeitnehmerin schuldlos erst nach Ablauf der 3-wöchigen Klagefrist Kenntnis von ihrer Schwangerschaft erlangt und diese nach § 17 MuSchG zur Unwirksamkeit der Kündigung führt. Der Antrag auf nachträgliche Klagezulassung ist allerdings nur innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung über das Vorliegen der Schwangerschaft zulässig.
Im Übrigen lässt das Arbeitsgericht die Klage gegen eine schriftliche Kündigung nach Ablauf der 3-Wochen-Frist nur zu, wenn ein Arbeitnehmer trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert war, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung zu erheben. Trotz dieser grundsätzlich bestehenden Möglichkeit gilt es, den Fristablauf unbedingt zu vermeiden.
Zur Fristwahrung genügt allgemein zunächst einmal die rechtzeitige Klageerhebung. Die Klage muss schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts eingereicht werden.
Nach § 6 KSchG kann sich ein Arbeitnehmer, der innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage eingereicht hat, in diesem Verfahren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz zur Begründung der Unwirksamkeit der Kündigung auch auf innerhalb der Klagefrist nicht geltend gemachte Gründe berufen.
Die dreiwöchige Frist gilt auch für Klagen gegen Kündigungen in Kleinbetrieben.
Ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar und hält der Arbeitnehmer die Kündigung für sozial ungerechtfertigt, kann er innerhalb einer Woche nach Erhalt der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Dies hat für den Beginn des Laufs der 3-Wochen-Frist jedoch keine Bedeutung. Dasselbe gilt für einen gegenüber dem Arbeitgeber erklärten Widerspruch gegen die Kündigung. Möchte man die Kündigung angreifen, muss fristgemäß eine Kündigungsschutzklage erhoben werden.
5. Kündigungsschutzklage auch bei Rücknahme der Kündigung?
Vorsicht bei einer Rücknahme der Kündigung durch den Arbeitgeber. Da es sich bei einer Kündigung um eine einseitige Willenserklärung handelt, hat diese zunächst Bestand und kann nicht einfach durch Widerruf seitens des Arbeitgebers beseitigt werden.
Es ist daher gefährlich auf eine mündliche Zusage des Arbeitgebers zu vertrauen, dass die Kündigung doch nicht gelten solle. Gehen Sie nicht innerhalb der 3-Wochen-Frist gerichtlich gegen die schriftliche Kündigung vor, gilt sie als wirksam und Sie können hiergegen grundsätzlich nichts mehr unternehmen.
Sie sollten bei einer mündlichen Rücknahme der Kündigung daher zusätzlich auf eine schriftliche Vereinbarung bestehen, die die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses regelt. Liegt diese nicht rechtzeitig vor Ablauf der 3-Wochen-Frist vor, müssen Sie zur Wahrung Ihrer Rechte zunächst eine Kündigungsschutzklage erheben.
6. Ablauf eines Kündigungsschutzprozesses
a. Hat der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber eine Kündigung erhalten und hält er diese für ungerechtfertigt, muss er beim zuständigen Arbeitsgericht eine so genannte Kündigungsschutzklage erheben.
Dies muss innerhalb einer Frist von drei Wochen geschehen, nachdem der Arbeitnehmer die Kündigung erhalten hat. Verpasst der Arbeitnehmer diese Frist, hat er praktisch keine Chance mehr sich mit einem Kündigungsschutzprozess gegen die Kündigung zu wehren.
Tipp:
Nehmen Sie sofort, nachdem Sie eine Kündigung erhalten haben, mit uns Kontakt auf. Unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht beraten Sie in Bezug auf Ihre individuelle Situation und besprechen mit Ihnen die weitere Vorgehensweise. Gerne auch im Rahmen eines persönlichen Termins in unserer Kanzlei.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Anwaltskosten in der ersten Gerichtsinstanz immer selbst bezahlen müssen, sofern Sie nicht über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, die die Kosten übernimmt. Dies gilt auch, wenn Ihre Klage erfolgreich ist.
Eine Kündigungsschutzklage beinhaltet immer die Feststellung, dass die vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung unwirksam ist.
Die Klage kann nicht auf die Zahlung einer Abfindung gerichtet sein, da das deutsche Arbeitsrecht im Grundsatz keinen Anspruch auf eine Abfindung im Falle einer Kündigung vorsieht, sondern der Erhalt des Arbeitsplatzes im Vordergrund steht.
Warum dennoch in den meisten Fällen eine Abfindung gezahlt wird, dazu weiter unten.
b. Wurde die Klage rechtzeitig beim Arbeitsgericht eingereicht, wird vom Gericht der so genannte Gütetermin anberaumt. Der Gütetermin findet recht schnell, in aller Regel innerhalb von wenigen Wochen nach Eingang der Klage statt.
In der Güteverhandlung wird noch nicht über die Wirksamkeit der Kündigung entschieden. Der Richter gibt im Gütetermin meist eine kurze vorläufige Einschätzung zu dem Fall ab und fragt an, ob zwischen den Parteien eine gütliche Einigung möglich ist.
In diesem Verfahrensstadium wird meist über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung verhandelt. Dies hat seinen Grund darin, dass beide Parteien ein Prozessrisiko tragen. Der Arbeitgeber riskiert die Zahlung des Annahmeverzugslohnes, sollte sich vor Gericht herausstellen, dass die Kündigung unwirksam war. Dies können schnell einige Monatsgehälter sein. Der Arbeitnehmer riskiert hingegen, dass er am Ende keinen Cent erhält, wenn die Kündigung wirksam war.
c. Kommt es zu einer Einigung im Gütetermin, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer sofort einen Vergleich abschließen und der Kündigungsschutzprozess ist beendet.
Kommt es zu keiner Einigung, dann wird der Kündigungsschutzprozess fortgeführt. Das bedeutet, dass ein neuer Gerichtstermin – der so genannte Kammertermin – vom Gericht bestimmt wird und das Gericht beiden Parteien die Gelegenheit gibt, ihre Argumente und Beweise schriftlich vorzubringen. Der Kammertermin wird meist einige Monate später stattfinden. In diesem Termin sitzen der Berufsrichter sowie zwei ehrenamtliche Richter (einer von Arbeitnehmerseite, einer von Arbeitgeberseite), die über die Wirksamkeit der Kündigung zu entscheiden haben. Es kann unter Umständen noch weitere Kammertermine geben.
d. Auch im Kammertermin wird das Gericht nochmals bei den Parteien anfragen, ob eine gütliche Einigung möglich ist. Auch in diesem Stadium können Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Vergleich schließen.
Kommt es zu keiner Einigung, wird das Gericht ein Urteil fällen. Es wird dann feststellen, ob die Kündigung wirksam und unwirksam war. Ein erstinstanzliches Verfahren dauert von der Klageerhebung bis zu einem Urteil ca. sechs Monate.
e. Dies muss noch nicht das Ende des Kündigungsschutzverfahrens sein. Die Partei, die den Rechtsstreit verliert, kann noch Berufung gegen das Urteil beim Landesarbeitsgericht einlegen.
In der Übersicht stellt sich dies wie folgt dar:

7. Kosten einer Kündigungsschutzklage
Die Kosten einer Kündigungsschutzklage setzen sich aus mehreren Positionen zusammen. Neben den Gerichtskosten sind dies bei Hinzuziehung eines Anwalts in der ersten Instanz auch die daraus resultierenden Anwaltskosten.
In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten hat in der ersten Instanz jede Partei unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ihre Anwaltskosten selbst zu tragen. Die Gerichtskosten trägt hingegen die Partei, die den Prozess verliert. Wird der Rechtsstreit im Wege eines Vergleichs beendet, fallen keine Gerichtskosten an.
Die Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten richtet sich jeweils nach dem Streitwert. Im Falle der Kündigungsschutzklage wird dabei regelmäßig die Summe der letzten drei Bruttomonatsgehälter zugrunde gelegt.
Verdient ein Arbeitnehmer beispielsweise monatlich 3.000 € brutto, beträgt der Streitwert 9.000 €. Auf Basis dieses Streitwerts werden sodann die Gerichts- und Anwaltskosten anhand von sogenannten Streitwerttabellen ermittelt.
Um Ihnen die komplexe Berechnung abzunehmen, haben wir einen Kostenrechner entwickelt und werden diesen demnächst online stellen. Hier müssen Sie nur Ihr Bruttomonatsgehalt sowie das Jahr angeben, in dem Sie die Tätigkeit für Ihren Arbeitgeber aufgenommen haben. Den Rest erledigt der Kostenrechner für Sie. Es werden drei mögliche Szenarien berechnet. Die angegebenen Kosten beinhalten dabei jeweils sowohl die Gerichts- als auch die Anwaltskosten.
8. Erfolgsquoten von Kündigungsschutzklagen
Laut der offiziellen Statistik der Arbeitsgerichtsbarkeit wurden im Jahr 2019 rund die Hälfte der Kündigungsrechtsstreitigkeiten durch einen Vergleich erledigt. Der Statistik lässt sich dabei nicht entnehmen, aus welchem Grund die andere Hälfte per Urteil oder anderweitig beendet wurde. Man darf jedoch u.a. davon ausgehen, dass zumindest in manchen Fällen trotz einer recht eindeutigen Wirksamkeit der Kündigung eine Kündigungsschutzklage erhoben wurde und diese somit von Beginn an zum Scheitern verurteilt war.
Daher kann an dieser Stelle nur noch einmal betont werden, dass man sich unmittelbar nach Erhalt einer Kündigung unbedingt fachkundigen Rat einholen sollte. Der Anwalt oder die Kanzlei Ihres Vertrauens mit Schwerpunkt Arbeitsrecht kann Ihnen eine fundierte Einschätzung der Erfolgsaussichten geben und das Bestmögliche für Sie herausholen.
Liegen Ansätze für die Unwirksamkeit der Kündigung vor, bestehen gute Aussichten auf die erfolgreiche Verhandlung einer angemessenen Abfindung.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich von unseren Anwälten mit langjähriger Berufserfahrung im Arbeitsrecht zu Ihrer individuellen SItuation beraten.
9. Fazit
Der Erhalt einer Kündigung ist für die meisten Arbeitnehmer nachvollziehbarerweise zunächst ein Schock. Die Kündigung kann aber aus einer Vielzahl von Gründen unwirksam sein. Die Folge hieraus wäre der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Dies können Sie jedoch nicht erreichen, indem Sie auf Ihren Arbeitgeber einreden oder gar überhaupt nichts unternehmen. Sie müssen zur Wahrung Ihrer Rechte vielmehr eine Kündigungsschutzklage erheben. Ob dies im Einzelfall Sinn macht, sollten Sie jedoch aufgrund der komplexen Gemengelage zunächst von einem fachkundigen Anwalt oder einer Kanzlei im Bereich Arbeitsrecht überprüfen lassen. Sieht er Erfolgsaussichten, stehen die Chancen gut, dass Ihr Arbeitsverhältnis fortbesteht oder dass er aufgrund seiner Erfahrung eine angemessene Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes für Sie verhandelt. Unsere Kanzlei ist Ihnen hierbei gerne behilflich.