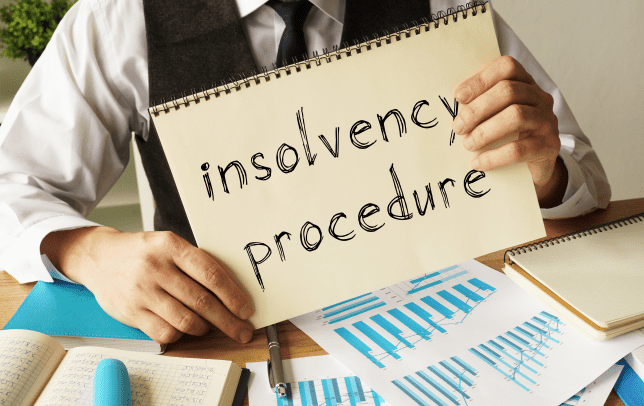Abgrenzungsfragen bei den Insolvenzeröffnungsgründen
Insolvenzreife
Das deutsche Insolvenzrecht kennt drei Insolvenzeröffnungsgründe: die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung, bei deren Vorliegen eine strafbewehrte Antragspflicht der Unternehmensleitung besteht sowie die drohende Zahlungsunfähigkeit, die lediglich ein Antragsrecht begründet.
Mittlerweile sind die Voraussetzungen und die Prüfungsfolge für das Vorliegen dieser Insolvenzgründe durch Rechtsprechung und Literatur, flankiert durch den Standard S 11 des Instituts für Wirtschaftsprüfer (IDW), relativ klar definiert.
Durch das Inkrafttreten des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG), das eine strukturierte Sanierung/Restrukturierung − anders als das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) − außerhalb eines Insolvenzverfahrens ermöglicht, stellen sich indes ganz neue und herausfordernde Abgrenzungsfragen.
- Die Zahlungsunfähigkeit
Am leichtesten fällt dabei noch die Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit. Ein Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht (mehr) in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 InsO). Dabei werden in einem ersten Prüfungsschritt stichtagsbezogen die an diesem Tag fälligen Verbindlichkeiten den an diesem Tag liquiden und verfügbaren Mitteln gegenübergestellt.
- Sind die Verbindlichkeiten noch zu mindestens 90 Prozent gedeckt, liegt keine insolvenzrelevante Zahlungsunfähigkeit vor.
- Ist dies indes nicht der Fall, ist diese Überprüfung nunmehr für einen dreiwöchigen Betrachtungszeitraum zu wiederholen. Kann auch in diesem Zeitraum die Unterdeckung nicht beseitigt werden, liegt grundsätzlich eine insolvenzrelevante Zahlungsunfähigkeit vor.
Der Geschäftsleitung wird gesetzlich eine Frist von maximal drei Wochen gegeben, die eingetretene Zahlungsunfähigkeit nachhaltig, also dauerhaft zu beseitigen. Spätestens nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist besteht eine Antragspflicht.
2. Drohende Zahlungsunfähigkeit
Von drohender Zahlungsunfähigkeit spricht das Gesetz, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht (mehr) dazu in der Lage sein wird, seine bestehenden Zahlungspflichten bei Fälligkeit zu erfüllen (§ 18 Abs. 2 InsO). Dies bedarf einer zeitlichen Bestimmung, die zuletzt mit einer Änderung bzw. Präzisierung der Insolvenzordnung, die zeitgleich mit der Einführung des StaRUG in Teilen reformiert wurde, erfolgt ist. Der gesetzliche Prognosezeitraum beträgt 24 Monate. Das heißt: Tritt aufgrund einer aktuellen Liquiditätsplanung innerhalb der folgenden 24 Monate eine wie oben beschriebene Liquiditätsunterdeckung ein, ist das betreffende Unternehmen heute drohend zahlungsunfähig. Das Eintreten dieses Insolvenzgrundes eröffnet der Geschäftsleitung sowohl die Möglichkeit – nicht die Pflicht – einen Insolvenzantrag zu stellen als auch ein Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG aufzunehmen und zu betreiben.
3. Überschuldung
Die größte „babylonische Sprachverwirrung“ herrscht – leider vermehrt auch in Fachkreisen und bei selbsternannten Experten – beim Insolvenzgrund der Überschuldung. Dabei klingt die gesetzliche Definition zunächst denkbar einfach. Doch dies ist trügerisch. Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners dessen bestehenden Verbindlichkeiten nicht (mehr) deckt (§ 19 Abs. 2 InsO). Dies suggeriert eine reine Vermögensvergleichsbetrachtung, auf die es im ersten Prüfungsschritt aber gar nicht ankommt.
Haftungsfalle Überschuldung
Denn im Gesetz heißt es weiter: „…es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich“. Es stellt sich deshalb zunächst die Frage, ob für das Unternehmen eine positive Fortbestehensprognose besteht. Und die Prüfung dessen wiederum ist eine reine Liquiditätsbetrachtung und hat mit der Vermögenssituation des Unternehmens zunächst rein gar nichts zu tun. Vielmehr liegt eine positive Fortbestehensprognose dann vor, wenn das Unternehmen für einen Zeitraum von zwölf Monaten durchfinanziert ist, also in diesem Zeitraum keine Zahlungsunfähigkeit im oben beschriebenen Sinne planerisch zu erwarten hat. In diesem Fall ist die Überschuldungsprüfung bereits beendet. Bei Vorliegen einer positiven Fortbestehensprognose liegt nämlich per se keine Überschuldung vor, egal wie schief die Bilanz auch aussehen mag.
Muss das Unternehmen hingegen innerhalb der kommenden zwölf Monate mit dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit rechnen, liegt keine positive Fortbestehensprognose mehr vor. Erst jetzt wird bei der Überschuldungsprüfung ein Vermögensvergleich und damit ein Blick in die Bilanz relevant. Denn eine negative Fortbestehensprognose hat zur Konsequenz, dass die Vermögensgegenstände zu Zerschlagungswerten angesetzt und den Verbindlichkeiten gegenübergestellt werden müssen; und schlimmer noch: In eine sodann aufzustellende Liquidationsbilanz sind auch Sonderpassiva, die erst durch die Liquidation ausgelöst werden, einzurechnen, wie bspw. Auslauflöhne, Kosten der Ausproduktion oder Schadensersatz für die Beendigung langlaufender Verträge.
Unter Berücksichtigung dessen werden dann bei den allermeisten Unternehmen die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten nicht mehr decken, und es liegt eine insolvenzrelevante Überschuldung vor, es sei denn, im Aktivvermögen versteckten sich erheblich stille Reserven, was eher die Ausnahme sein dürfte.
Drohende Zahlungsunfähigkeit versus Überschuldung
Die Abgrenzung der drohenden Zahlungsunfähigkeit von der Überschuldung wird gerade bei der Frage relevant, ob ein in die Krise geratenes Unternehmen das neu geschaffene Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG, also eine strukturierte Sanierung ohne Insolvenz, überhaupt nutzen kann. Denn dieses Verfahren steht nur und ausschließlich drohend zahlungsunfähigen Schuldnern zur Verfügung, die eben noch nicht zahlungsunfähig oder überschuldet sind.
Hat das betreffende Unternehmen beispielsweise aufgrund heutiger Planung in 18 Monaten die Zahlungsunfähigkeit zu gewärtigen, steht einem StaRUG-Verfahren nichts im Wege. Tritt aber planerisch eine Zahlungsunfähigkeit z. B. bereits nach zehn Monaten ein, ist der Eintritt ins StaRUG-Verfahren einerseits wegen drohender Zahlungsunfähigkeit möglich, gleichsam aber wegen der gleichzeitig vorliegenden Überschuldung ausgeschlossen.
Dieses Dilemma löst das Gesetz bedauerlicherweise nicht zufriedenstellend auf. Vielmehr helfen hier allenfalls die Gesetzesmotive und Erläuterungen zu den maßgeblichen Normen der Insolvenzordnung und des StaRUG. Dort ist zu lesen, dass, so lange von einer die Überschuldung ausschließenden positiven Fortbestehensprognose auszugehen ist, wie eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, ein StaRUG-Verfahren erfolgreich zu führen.
Dies bedeutet in der Praxis, dass die Geschäftsleitung eines nicht für die Dauer von zwölf Monaten durchfinanzierten und damit in aller Regel überschuldeten Unternehmens in Anbetracht ihrer strafbewehrten Antragspflicht auf jeden Fall handeln muss. Soll der Gang zum Insolvenzgericht vermieden werden, muss eine positive Fortbestehensprognose entweder durch die Beseitigung der innerhalb eines Jahres drohenden Illiquidität oder aber durch ernsthaftes und erfolgversprechendes Betreiben eines StaRUG-Verfahrens erreicht werden.
In diesen Abgrenzungsfragen schlummert ein nicht unerhebliches Haftungspotenzial, das in den meisten Führungsetagen deutscher Unternehmen vermutlich noch weitgehend unbekannt ist oder zumindest unterschätzt wird.
Zurück zur Newsletter Artikel-Übersicht.