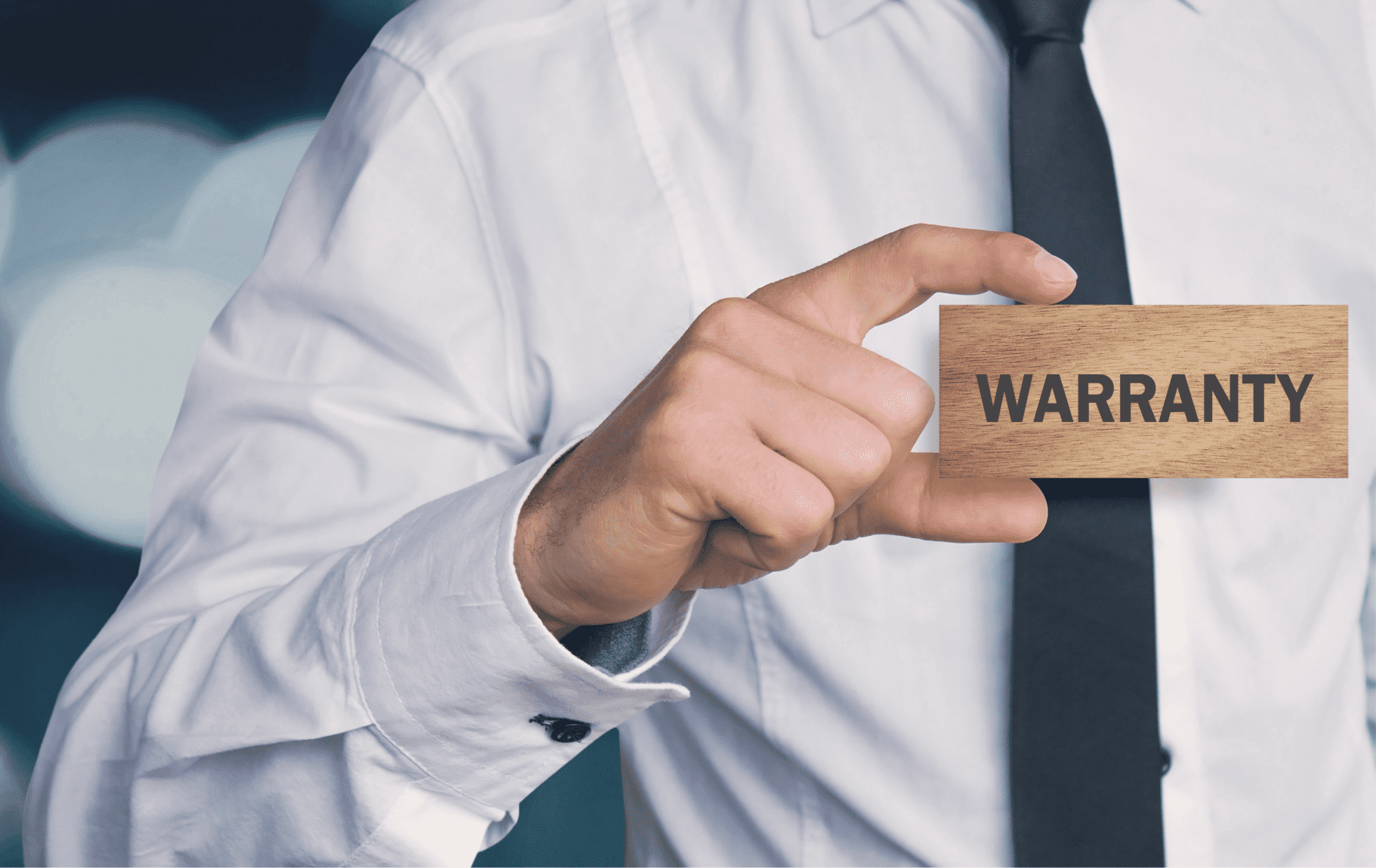Verminderung des Missbrauchsrisikos von Zahlungsgarantien: Sicherungszweck so eng wie möglich halten
Zur Sicherung von Forderungen auf Vertragserfüllung, Gewährleistung − aber auch auf Rückerstattung von Anzahlungen – werden, insbesondere im internationalen Rechtsverkehr, häufig Zahlungsgarantien eingesetzt. Diese Garantien sind in der Regel auf erstes schriftliches Anfordern zahlbar. Auch sind Garantieforderungen, anders als Forderungen aus Bürgschaften, unabhängig vom Bestand sowie der Einredefreiheit der gesicherten Grundforderung durchsetzbar. Dies begründet für den Avalauftraggeber, also diejenige Partei, die gegenüber ihrer Bank die Garantie in Auftrag gegeben hat, ein nicht unerhebliches Risiko. Denn die Bank wird bei formell ordnungsgemäßer Inanspruchnahme der Garantie regelmäßig an den Garantienehmer leisten und sodann bei dem Avalauftraggeber Regress nehmen. Eine Prüfung, ob die Inanspruchnahme der Garantie materiell berechtigt ist, nimmt sie regelmäßig nicht vor.
Das daraus resultierende Risiko einer missbräuchlichen Inanspruchnahme der Garantie lässt sich jedoch deutlich einschränken, indem die zu besichernde Forderung möglichst genau bezeichnet wird.
Dies illustriert sehr anschaulich der folgende Sachverhalt, der dem OLG Frankfurt zur Entscheidung vorlag:
Die Garantiebegünstigte bestellte bei der Avalauftraggeberin 17.880 Fotovoltaik Module mit einer Sollleistung von 315 W je Modul zu einem Kaufpreis von 1.445.793,30 Euro und leistete hierauf eine Anzahlung von 10 Prozent des Kaufpreises, mithin 144.579,33 Euro.
Diese Anzahlung wurde vertragsgemäß durch eine Anzahlungsgarantie der später beklagten Bank besichert.
In der formularmäßig erteilten Garantie heißt es, die Garantin übernehme unwiderruflich und unter Verzicht auf Einwendungen aus dem Kaufvertrag die Verpflichtung zur Erstattung des durch den Käufer angeforderten Betrags an diesen bis zum Höchstbetrag der Garantie auf erste schriftliche Anforderung des Käufers, in welcher dieser zugleich bestätige, dass der Verkäufer die Ware nicht geliefert habe und seiner Verpflichtung, die Vorauszahlung zurückzuzahlen, nicht nachgekommen sei.
Nach Lieferung von insgesamt 13.680 Modulen wurden Modultests durchgeführt, die nach Behauptung der Garantiebegünstigten eine Minderleistung ergaben. Ein daraufhin eingeholtes Gutachten des TÜV Rheinland weist eine durchschnittliche Leistung von 305,3 W aus.
Die Garantiebegünstigte forderte die Bank in zwei Schreiben vom 11.03.2019 bzw. 15.03.2019 erfolglos zur Zahlung auf. Während es im ersten Schreiben heißt, dass die gelieferten Module eine weit niedrigere Leistung als 315 W aufwiesen, lautet die Bestätigung der Garantiebegünstigten im zweiten Schreiben vom 15.03.2019, die Verkäuferin habe die Ware nicht geliefert und sei ihrer Verpflichtung, die Vorauszahlung zurückzuzahlen, nicht nachgekommen.
Das Landgericht Frankfurt hat der daraufhin erhobenen Klage der Garantiebegünstigten gegen die Bank stattgegeben. Durch Urteil vom 27.01.2022, Az. 10 U 40/20, hat das OLG Frankfurt die Entscheidung des Landgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es folgendes ausgeführt:
„Zwar hat das Landgericht zutreffend angenommen, dass mit dem Anforderungsschreiben vom 15.3.2019 die formellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Garantie erfüllt waren und damit ohne Rücksicht auf Einwendungen aus dem Grundgeschäft grundsätzlich ein Zahlungsanspruch der Klägerin zum Entstehen gelangt sein konnte. Die Zahlungsverpflichtung der Garantiebank findet jedoch da ihre Grenze wo die Inanspruchnahme rechtsmissbräuchlich und dies liquide beweisbar ist. Dies kommt in Betracht, wenn die zu sichernde Forderung nicht besteht oder die Garantie für andere als die vertraglich vereinbarten Zwecke in Anspruch genommen wird. Beides ist hier evident der Fall.“
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Sicherungszweck einer Garantie so eng wie möglich gefasst werden sollte.
Eine weitere Einschränkung des Risikos missbräuchlicher Inanspruchnahmen einer Garantie kann − unter Nutzung des Grundsatzes der formellen Garantiestrenge − dadurch erreicht werden, dass die Zahlungspflicht unter der Garantie von der Abgabe einer Erklärung des Garantiebegünstigten abhängig gemacht wird, die der Garant liquide widerlegen kann, wenn die gesicherte Forderung nicht entstanden oder mit Einreden behaftet ist. Daher sollte der Avalauftraggeber vor Erteilung des Avalauftrags prüfen, welche tatsächlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die durch die Garantie besicherte Forderung entstehen bzw. fällig werden kann. Die Abgabe einer entsprechenden Erklärung des Garantiebegünstigten sollte als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie in den Garantietext aufgenommen werden.
Zurück zur Newsletter Artikel-Übersicht.